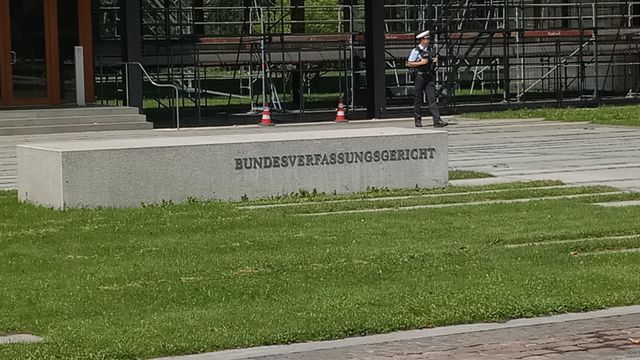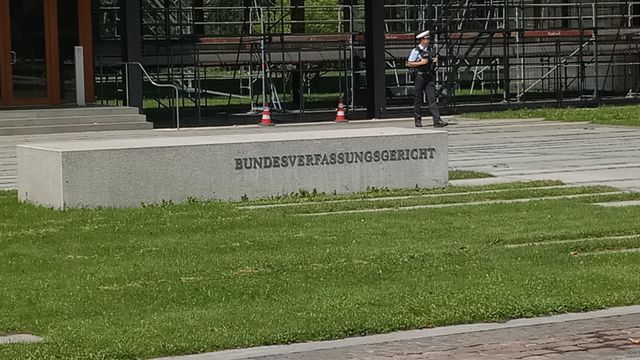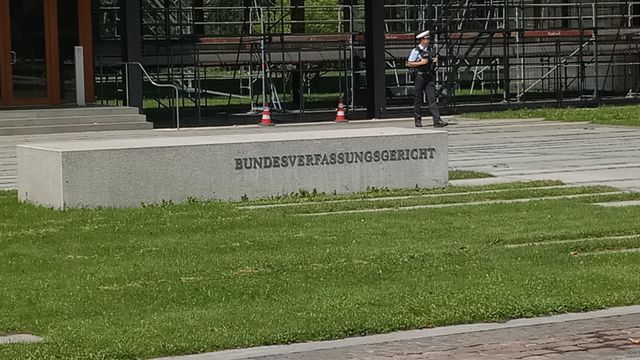Ein Antrag auf ein Verbot der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) wirft eine Reihe komplexer Fragen auf. Neben der politischen Brisanz eines solchen Vorhabens stehen die Akteure vor langwierigen Abläufen, und zwar sowohl vorgelagert innerhalb des Verfassungsschutzes als auch in den Verfahren vor den Verwaltungsgerichten und letztlich vor dem Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD insgesamt als "gesichert rechtsextremistisch" erkannt. Die AfD klagt gegen die Veröffentlichung dieser Erkenntnis, was aber an der fachlichen Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz nichts ändert. Ist es wirklich nötig, die Rechtskraft der nachgelagerten Gerichtsverfahren abzuwarten, bevor die Prüfung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungsgericht angegangen wird? Es muss niemand hellsehen können, dass ein Verbotsverfahren dann erst in vielen Jahren angegangen werden könnte.
1. Verfassungsrechtliche Grundlagen des Parteiverbots
Nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes sind Parteien verfassungswidrig, die
„nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden“.
Das Bundesverfassungsgericht ist die einzige Instanz, die eine solche Verfassungswidrigkeit feststellen kann. Mehr als einen darauf gerichteten Antrag aus einem der antragsberechtigen Gremien Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung bedarf es nicht. Natürlich kommt es auf eine ausführliche und außerordentlich gut vorbereitete Begründung eines Verbotsantrages an, auf deren Grundlage das Bundesverfassungsgericht ermitteln muss, ob eine Partei verfassungswidrig ist.
2. Der Verfassungsschutz und die Vorarbeiten
Die Verfassungsschutzbehörden leisten den wesentlichen Beitrag zur Schaffung einer Bewertungsgrundlage für die Begründung eines Verbotsantrages, denn deren Kernaufgabe ist die Sammlung und Analyse von Informationen über verfassungsfeindliche Bestrebungen.
Angesichts dessen sollte man sich vergegenwärtigen, dass es für die Stellung eines Verbotsantrages weder einer Einstufung der AfD durch eine Verfassungsschutzbehörde und erst recht keiner rechtskräftigen gerichtlichen Bestätigung einer solchen Bewertung bedarf. Die Begriffe „Prüffall“, „Verdachtsfall“ und „gesichert extremistisch“ entspringen nicht dem Gesetz, sondern stellen ausschließlich interne Arbeitsstufen der Verfassungsschutzbehörden dar. Dies bedeutet: Eine Einstufung als „gesichert extremistisch“ durch eine Behörde des Verfassungsschutzes ist sicher inhaltlich hilfreich, aber keine rechtliche Voraussetzung für einen Verbotsantrag.
Zur Verdeutlichung füge ich noch eine historische Perspektive hinzu: Bei der Schaffung des Grundgesetzes 1949 einschließlich der Regeln der wehrhaften Demokratie samt Parteiverbot wurde der Verfassungsschutz noch nicht mit geboren, sondern erst im Jahr 1950 gegründet.
Daraus resultiert die Frage: Warum sollte auf eine Einstufung der AfD als “gesichert rechtsextremistisch” oder sogar die Rechtskraft des daraufhin mit Sicherheit folgenden Verwaltungsgerichtsverfahrens gewartet werden?
Die Antwort fällt leicht: Für weiteres Warten besteht keine Veranlassung.
3. Verwaltungsgerichte und der Schutz der Grundrechte
Die Verfahrensdauern in der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in vielen Bundesländern deutlich zu lang. Einzelne Bundesländer sind diesem Phänomen mit einer deutlichen Personalaufstockung begegnet, andere nicht.
Die Einstufung der AfD als Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz erfolgte zu Jahresbeginn 2021. Schon zu Anfang 2019 waren der “Flügel” der AfD und deren Jugendorganisation Junge Alternative als Verdachtsfall eingestuft worden.
Die AfD hat dagegen geklagt. Die Klage hat das Bundeverwaltungsgericht als letzte Instanz erst im Juli 2025 abgewiesen.
Die Dauer der mehrstufigen Gerichtsverfahren zeigt, dass nicht auf die Rechtskraft gewartet werden sollte. Das ist auch nicht nötig.
4. Das Bundesverfassungsgericht und das Parteiverbotsverfahren
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet ungeachtet der Auffassung der Verfassungsschutzbehörden, die auch selbst nicht direkt an einem Verbotsverfahren beteiligt sind, ausschließlich nach einem eigenen Eindruck einer selbst gestalteten Beweisaufnahme.
Ein solches Verfahren wird komplex und zeitaufwendig. Das Bundesverfassungsgericht muss nicht nur die gesammelten Beweise prüfen, sondern auch die Verhältnismäßigkeit eines Parteiverbots bewerten. Das Beispiel des letzten NPD-Verbotsverfahrens zeigt, wie langwierig solche Prozesse sein können. Allein von Antragstellung bis zum Urteil dauerte das Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die NPD von 2013 bis 2017, ehe das Bundesverfassungsgericht entschied, die Partei trotz verfassungsfeindlicher Bestrebungen nicht zu verbieten, da sie zu unbedeutend sei, um die freiheitliche demokratische Grundordnung tatsächlich zu gefährden.
Eine Verfahrensdauer unterhalb von zwei Jahren erscheint nicht möglich.
5. Schlussfolgerung
Die politische Entscheidung über die Stellung eines Verbotsantrages darf nicht mehr lange aufgeschoben werden.
Unser Grundgesetz enthält Elemente der wehrhaften Demokratie zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Ein Verbot der AfD in der über-über-nächsten Legislaturperiode des Bundestages könnte ernsthaft zu spät kommen. Wir müssen für diesen Fall vorausschauend handeln.